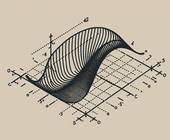Arbeiten in verteilten Teams
13.01.2020, 00:00 Uhr
Getrennt marschieren, vereint schlagen
Arbeiten zu Hause irgendwo auf der Welt – worauf müssen verteilte Teams achten?
Vor knapp zehn Jahren, 2010, haben Cali Ressler und Jody Thompson in ihrem Buch die Idee einer „Results-Only Work Environment“ (kurz ROWE) vorgestellt [1]. Der Begriff beschreibt eine Arbeitsweise, bei der nicht zählt, wann oder wo gearbeitet wird, sondern nur, ob die gewünschten Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Dass zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten grundsätzlich nur für solche Teams funktionieren kann, die gemeinsam an einem virtuellen Produkt arbeiten, ist offensichtlich, doch etwas anderes fordern die beiden Autorinnen mit ROWE auch gar nicht.
Das klingt radikal, revolutionär, verlockend – und zugleich auch furchteinflößend und kompliziert in der Umsetzung. Wer sich näher mit dem Thema beschäftigt, stößt rasch auf Fragen nach der fairen Bewertung von Arbeit und zahlreiche andere praktische Probleme. Dabei wäre ein solches Arbeiten in der Theorie so schön.
Die Vorteile für die Arbeitnehmer liegen klar auf der Hand. Wer selbst bestimmen kann, wann und wo er arbeitet, hat eine bessere Work-Life-Balance. Er verschwendet keine Lebenszeit mehr in Staus oder öffentlichen Verkehrsmitteln, hat mehr Zeit für Kinder und Familie, kann Arbeiten und Reisen miteinander kombinieren. Sofern ein Mobiltelefon, ein Notebook und ein verlässlicher Internetzugang vorhanden sind, spielt es keine Rolle, ob man von zu Hause aus arbeitet oder vom Pool auf den Malediven, ob man in Pretoria oder in Paris lebt, lieber morgens, abends oder gar nachts arbeitet.
Auch für Unternehmen bietet eine solche Arbeitsweise zahlreiche Vorteile. Wer die Suche nach Mitarbeitern nicht auf einen Ort beschränken muss, verbessert die Chancen deutlich, den dringend benötigten Experten auch tatsächlich zu finden. Ein einziger Blick auf eine beliebige Statistik zum Fachkräftemangel belegt, dass dies ein durchaus gewünschter Effekt sein könnte. Je jünger Mitarbeiter sind, desto wichtiger ist es ihnen zudem tendenziell, Privatleben und Beruf vereinen zu können, und welches Unternehmen möchte diesem durchaus nachvollziehbaren Wunsch schon gerne künstlich im Wege stehen?
Die gute Nachricht ist, dass die IT-Branche für diese Arbeitsweise prinzipiell hervorragende Voraussetzungen mitbringt. Anders als die industrielle Produktion haben sowohl die Entwicklung als auch die Forschung den großen Vorteil, rein virtueller Artefakte zu bedürfen. Befinden sich zwei Entwickler im gleichen Büro, ziehen sie sich häufig mithilfe von rauschunterdrückenden Kopfhörern zurück, um ungestört voneinander und konzentriert arbeiten zu können. Den Sinn eines gemeinsamen Büros konterkariert das natürlich. Einige Unternehmen schätzen paarweises Programmieren, doch auch hierfür sind Großraumbüros nicht geeignet, da die einzelnen Pärchen einander stören und ablenken. Im schlimmsten Fall versucht jeder, den anderen zu übertönen, was zu einer endlosen Spirale führt. Wäre die Arbeit hingegen räumlich verteilt, könnte jeder ungestört für sich arbeiten und sich im Bedarfsfall mit anderen virtuell verbinden, ohne zusätzliche Geräuschbelastung durch Dritte.
Wie sieht nun eine solche Arbeitsweise in der Realität aus? Was sind die Voraussetzungen aufseiten der Unternehmen und der Mitarbeiter, damit Remote-Arbeit, also das Arbeiten beispielsweise von zu Hause aus, gelingen kann? Wo liegen die Stolperfallen, worauf gilt es zu achten? Und: Ist das Ganze am Ende tatsächlich ein Traum, oder entwickelt es sich eher zum Albtraum?
Hardware
Ein wichtiger Faktor, damit eine verteilte Arbeitsweise gelingen kann, wurde oben bereits angesprochen:
„Sofern ein Mobiltelefon, ein Notebook und ein verlässlicher Internetzugang gegeben sind, spielt es keine Rolle, ob man von zu Hause aus arbeitet oder vom Pool auf den Malediven, ob man in Pretoria oder in Paris lebt, ob man lieber morgens, abends oder gar nachts arbeitet.“
Wer nicht an einem Ort zusammenkommt, um gemeinsam zu arbeiten, muss diesen Ort auf virtuelle Weise erschaffen. Dazu gehört die Anschaffung geeigneter Hardware oder das Schaffen geeigneter räumlicher und technischer Rahmenbedingungen. Wer ausschließlich von zu Hause aus arbeitet, kommt eventuell noch mit einem Desktop-Computer aus. Wer jedoch regelmäßig unterwegs ist, benötigt ein gut ausgestattetes Notebook, das einem Desktop-Computer im Hinblick auf CPU, RAM und SSD nicht nachsteht. Immerhin muss der tragbare Rechner in dem Fall nicht den Desktop-PC ergänzen, sondern er wird zum primären Gerät, das gegebenenfalls zu Hause noch durch externe Monitore ergänzt wird. Das bedeutet, dass das Notebook auch über eine ausgezeichnete Tastatur, ein hervorragendes Touchpad und ein Display verfügen sollte, das auch bei Tageslicht noch akzeptabel lesbar bleibt.
Für den mobilen Internetzugang ist ein Smartphone unumgänglich, das unterwegs auch als Hotspot für andere Geräte wie das Notebook dienen kann. Dass das nur dann vernünftig funktioniert, wenn auch ein – im Idealfall unbegrenzter – Datentarif mit LTE-Geschwindigkeit zur Verfügung steht, versteht sich von selbst. Zusätzlich ist als Backup ein Internetzugang empfehlenswert, der nicht an den Mobilfunk gekoppelt ist. Das gilt zumindest dann, wenn man regelmäßig an einem festen Ort arbeitet. Wer ausschließlich unterwegs arbeitet, dem nützt das natürlich wenig.
Apropos fester Ort zum Arbeiten: Es ist keine gute Idee, sich ins heimische Wohnzimmer oder an den Esstisch zu setzen. Die zunächst offensichtliche und naheliegende Idee stellt sich bereits nach kurzer Zeit als schlechte Idee heraus. Mit der Ruhe, die zum Arbeiten erforderlich ist, ist es in diesen Räumen in der Regel nämlich nicht zum Besten bestellt – außer natürlich, man wohnt alleine. Von zu Hause aus zu arbeiten bedeutet auch für die Familie, zu akzeptieren, dass man trotz physischer Präsenz nicht jederzeit ansprechbar ist. Daher eignet sich ein eigenständiger und abgetrennter Raum besser, der als Büro eingerichtet wird. Eine andere Möglichkeit wäre ein Büro oder zumindest ein Schreibtisch in einem der in vielen Städten vertretenen Co-Working-Spaces.
Theoretisch ist das Arbeiten auch an anderen Orten denkbar, beispielsweise bei Starbucks, am Pool oder in einem Zelt. Zu beachten ist dabei jedoch, dass die Ergonomie von Schreibtisch und Schreibtischstuhl gewahrt bleibt. Auch das Verbinden von Arbeiten mit Reisen soll und darf die Gesundheit nicht langfristig gefährden oder gar beeinträchtigen. Es ist eine Sache, sich nach Lust und Laune auf die Liege am Pool oder die Couch zurückziehen zu können, aber eine ganz andere, es in Ermangelung eines eher konventionell ausgestatteten Arbeitsplatzes zu müssen.
Nicht jede Softwareentwicklung funktioniert außerdem rein virtuell. Gelegentlich ist zusätzliche Hardware erforderlich, von üblichen Bürogeräten wie Druckern und Schreddern bis hin zu Spezial-Hardware für die jeweilige Aufgabe. Während es üblicherweise kein Problem sein dürfte, dass einem Mitarbeiter auch außerhalb eines Büros ein Drucker oder ein Schredder zur Verfügung steht, wird es bei fachspezifischer Hardware schon schwieriger: Wer beispielsweise Programme zum Steuern von Industriegeräten entwickelt und dafür gelegentlich auf echte Hardware zurückgreifen muss, wird eventuell nicht vollständig remote arbeiten können.
Software
Geeignete Hardware und ein passendes Umfeld sind aber nur ein Teil des Gesamtbildes: Eine ebenso wichtige Rolle spielt die verwendete Software. Selbstverständlich unterscheidet sich nicht die Programmiersprache, weil man zu einer anderen Zeit oder an einem anderen Ort arbeitet, aber eine andere Arbeitsweise hat Einfluss auf das Software-Ökosystem, das die eigentliche Entwicklung umgibt. Das beginnt damit, dass sich die Versionsverwaltung des Unternehmens nicht auf einem Server befinden darf, auf den Sie nur innerhalb eines LANs zugreifen können. Stattdessen muss er problemlos von außen erreichbar sein. Daher bietet sich der Einsatz einer verwalteten Lösung wie beispielsweise GitHub oder GitLab an.
Theoretisch kann man auch einen eigenen Server über ein VPN ins Internet bringen, doch schafft das letztlich häufig mehr Probleme, als es löst. Dazu bedarf es nämlich nicht nur einer Versionsverwaltung, sondern auch eines Build- und Testservers. Eine tragfähige und verlässliche CI/CD-Infrastruktur aufzusetzen ist ohnehin eine komplexe Herausforderung – das wird durch die Anforderung, auch von außen flexibel darauf zugreifen zu können, nicht einfacher. Daher gilt auch hier, dass es oft eine bessere Idee ist, diese Dienste auszulagern und als verwaltete Lösungen in der Cloud zu mieten. Der Spieß wird also praktisch umgedreht und der Zugriff von außen zur Regel anstatt ein Spezialfall.
Das Vorgehen ist aber auch unabhängig von dem Thema eine gute Idee, denn das Aufsetzen und Betreiben einer Versionsverwaltung und einer CI/CD-Pipeline dürfte bei den wenigsten Unternehmen zum Kerngeschäft gehören. Warum also den Aufwand betreiben und es letztlich schlechter und teurer selbst machen, als es gut und sicher einzukaufen?
Gleiches gilt auch für die Anwendungen, die zur Kommunikation verwendet werden. Office 365, Slack und Co. sind für den Zugriff aus dem Internet ausgelegt, im Gegensatz zu dem von der internen IT betriebenen Lotus-Notes-System. Unternehmen müssen sich bei all diesen Themen die Frage stellen, welcher Vorteil sich daraus ergibt, sich selbst um Aufgaben zu kümmern, die sich problemlos auslagern ließen, weil sie das eigene Kerngeschäft nicht voranbringen. Die Hürden für den produktiven Einsatz solcher Systeme gilt es dann so niedrig wie möglich zu machen.
Apropos Office 365 und Slack: Beginnt man, zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten zu arbeiten, verringert das automatisch die Möglichkeiten zur synchronen Kommunikation. Die Häufigkeit von persönlichen Gesprächen nimmt ebenso ab wie die von Telefonaten. Der mobile Kollege muss daher mehr schreiben als sprechen und auch Entscheidungen selbst in kleinen Teams häufiger schriftlich festhalten und sie so teilen, dass alle Teammitglieder informiert sind. Dafür ist ein Chat wie Slack die ideale Plattform: Er ersetzt quasi den Flurfunk. Die große Kunst dabei besteht darin, die richtige Balance zwischen ausreichend Signal und möglichst wenig Rauschen zu finden. Sehr hilfreich ist dabei die Möglichkeit, unterschiedliche Kanäle für verschiedene Themen einzurichten.
Wird der Chat darüber hinaus mit Bots gekoppelt, die regelmäßig wiederkehrende Aufgaben übernehmen, bewegt sich das Ganze in Richtung ChatOps. Warum beispielsweise sollte man Erinnerungen an (virtuelle) Meetings von Hand in den Kalender eintragen, wenn diese Aufgabe ebenso gut ein Bot per Chat übernehmen kann? Warum sollte man ein Repository auf GitHub von Hand anlegen, wenn ein Bot, der sich über den Chat ansteuern lässt, dasselbe vermag? Verlagern sich mehr und mehr der wiederkehrenden Aufgaben in den Chat, wird gleichzeitig auch deutlicher und transparenter, wer woran arbeitet.
Die asynchrone Kommunikation erfordert aber auch eine andere Herangehensweise bei den Mitarbeitern. Wer beispielsweise aus Gründen der Zeitverschiebung keine Möglichkeit hat, bei einem Problem den Kollegen nebenan zu fragen, muss sich anders behelfen. Das eigenständige Lösen von Problemen und das zielgerichtete Kommunizieren von Problemen und Lösungen sind dabei essenziell. Das Team muss sich über den Chat so organisieren, dass trotz der zeitlichen und räumlichen Distanz ein Informationsfluss und Transparenz geschaffen werden.
Kultur
Das alles funktioniert aber nur, wenn neben der Hardware und der Software noch ein weiterer Baustein stimmt: die Kultur. Die besten Werkzeuge nützen nichts, wenn das Zwischenmenschliche in einem Team nicht stimmt. Da jedoch gerade das bei Remote-Teams auf ein Minimum reduziert ist, gelten für alle Beteiligten weitaus höhere Anforderungen. Das betrifft im Wesentlichen drei Aspekte.
Der erste Aspekt ist, dass ein Grundvertrauen auf allen Seiten gegeben sein muss. Unternehmen müssen darauf vertrauen, dass Mitarbeiter tatsächlich nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten und sich nicht – weil es vermeintlich ohnehin niemand mitbekommt – einen entspannten Urlaubstag machen, allen anderen gegenüber aber behaupten, sie hätten intensiv über der Lösung eines anspruchsvollen Problems gegrübelt. Mitarbeiter müssen darauf vertrauen, dass sie tatsächlich an ihren Ergebnissen gemessen werden und nicht an der Zahl der Präsenzminuten in Slack: Es darf keine allzu große Rolle spielen, ob für das richtige Ergebnis ein Tag mehr oder weniger nötigt war.
Natürlich muss sich alles in einem gewissen Rahmen bewegen, aber Mitarbeiter müssen offen sagen können, dass sie für eine Aufgabe mehr Zeit benötigen, ohne dass ihnen das anlasslos zu ihren Ungunsten ausgelegt wird.
Interessant dabei ist, dass das eigentlich auch für solche Teams gilt, die komplett vor Ort zusammenarbeiten. Die Tatsache, dass jemand acht Stunden auf seinem Platz angestrengt nachdenkend vor einem Bildschirm sitzt, heißt nicht, dass er auch tatsächlich acht Stunden arbeitet. Ganz im Gegenteil, vielleicht denkt er auch acht Stunden darüber nach, wie es am wenigsten auffällt, dass er nicht arbeitet. In der virtuellen Welt muss man sich davon lösen, dass physische Präsenz auch zugleich Wertschöpfung bedeutet. Dieser Illusion erliegen leider immer noch viele Unternehmen. Wenn man einander nicht vertraut, ist es völlig unerheblich, ob man sich zur gleichen Zeit im gleichen Raum befindet oder nicht – das Problem liegt dann ein gutes Stück tiefer.
Zum Vertrauen gehört schließlich auch das Bewusstsein, die Grenzen des jeweils Anderen zu respektieren. Nicht online zu sein heißt, nicht online zu sein. Damit müssen sich sowohl Kollegen als auch Vorgesetzte abfinden. Wer nicht online ist, ist gerade nicht erreichbar. Diese Freiheit muss gewährt werden, weil man ansonsten Gefahr läuft, „always on“ sein zu müssen.
Mit dieser Freiheit geht auf der anderen Seite aber auch ein hohes Maß an Verantwortung einher: Wer sich seine Zeit frei einteilen kann, ist gut beraten, im Vorfeld klarzustellen, wann er erreichbar sein wird und wann nicht. Es gibt Situationen, in denen es durchaus vertretbar ist, wenn jemand „einfach so“ abwesend ist – im Normalfall sollte das Team aber Bescheid wissen, ob jemand grundsätzlich an- oder abwesend ist, und wann das ungefähr sein wird.
Das führt zum zweiten wichtigen Aspekt der Kultur, der Kommunikation. Fehlt das direkte Gegenüber, ist es schwieriger, Emotionen zu deuten, da Gestik und Mimik ausgeblendet sind. Man muss sich also Mühe geben, den anderen zu verstehen, und versuchen, sich in den anderen hineinzuversetzen. Das gilt für beide Seiten: Wer etwas möchte, weil beispielsweise eine Frage zu klären ist, muss den Kontext mitliefern, um den es geht. Er muss alle Informationen bereitstellen, die es dem Antwortenden einfach machen, zu antworten – ohne dass dieser noch etliche Male nachfragen muss. Der Antwortende wiederum muss sich die Zeit nehmen, sich in eine Frage hineinzudenken, und darf den Fragenden nicht mit pauschalen Floskeln abwimmeln.
Das zählt in gewissem Sinne auch zu dem Aspekt des Vertrauens, dass man einander respektiert und darauf vertraut, dass beide sich bemühen, zielgerichtet und auf Augenhöhe miteinander zu interagieren. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist auch, Fehler einzugestehen. Kritik bleibt bei keiner Arbeit aus, aber bei einer verteilten Arbeitsweise ist es einerseits viel leichter, Kritik zu äußern, und andererseits viel schwieriger, Kritik zu akzeptieren, da für beide Seiten wiederum das persönliche Gegenüber fehlt. Daher ist es enorm wichtig, Kritik stets an der Sache und nicht an der Person festzumachen und das auch immer wieder herauszustellen. Das typische „Die und wir“-Denken muss zudem über Bord geworfen werden. Alle sind „ein“ Team, das entweder gemeinsam gewinnt oder gemeinsam verliert.
Der dritte Aspekt ist schließlich, für Transparenz zu sorgen. Wer darüber Bescheid weiß, woran andere arbeiten, womit sie sich beschäftigen, mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben, was sie beschäftigt und wie es ihnen geht, dem fällt es leichter, zu vertrauen und Kommunikation richtig einzuordnen. Dazu gehört aber auch, selbst dafür zu sorgen, dass transparent wird, woran man selbst gerade arbeitet, womit man sich beschäftigt, mit welchen Problemen man zu kämpfen hat, was einen beschäftigt und wie es einem geht. Transparenz ist keine Einbahnstraße, sondern erfordert den gleichen Einsatz von jedem Beteiligten. Wer glaubt, dass das in einem verteilten Team nicht möglich sei, denke an Brieffreundschaften, die zwei Menschen teilweise über Jahre intensiv verbinden, obwohl sie sich unter Umständen noch nie in ihrem Leben begegnet sind.
Transparenz bedeutet auch, zu wissen, wer wofür zuständig ist. An wen muss man sich wofür wenden? Kümmern sich andere, wenn jemand Probleme bekundet? Der geforderten Selbstständigkeit ist an dieser Stelle noch eine zweite Komponente zur Seite zu stellen, nämlich die Hilfsbereitschaft: Wer regelmäßig darauf angewiesen ist, Nüsse selbst zu knacken, weiß um so mehr zu schätzen, wenn sich jemand anderes trotz der zeitlichen und räumlichen Distanz die Zeit nimmt, zu helfen. Diese Hilfe muss aber auch gewährt werden, schließlich sitzen in einem komplett verteilten Team alle in einem Boot und jeder ist über kurz oder lang einmal derjenige, der Hilfe bei irgendetwas benötigt.
Ein gutes Mittel, um Transparenz zu schaffen, ist dabei übrigens das virtuelle Programmieren in Paaren. Ganz abgesehen davon, dass ein beständiges Vier-Augen-Prinzip der Codequalität guttut, trägt es auch enorm dazu bei, Wissensinseln zu vermeiden, und verhindert effektiv, dass einzelne Mitarbeiter immer weiter in einen Sumpf abdriften, in den niemand mehr folgen kann. Außerdem bewirkt das Programmieren in Paaren auch, dass sich Gespräche entwickeln können, die über die konkret zu bearbeitende Aufgabe hinausgehen. Wer regelmäßig miteinander spricht, hat auch regelmäßig die Gelegenheit, sich mit anderen über Privates auszutauschen. Natürlich muss nicht jeder jedem alles erzählen, aber die Frage, wie das vergangene Wochenende war, würde vor Ort ebenso gestellt. Vielleicht kommt man mit dem ein oder anderen zu zweit viel eher ins Gespräch, als man zunächst meint.
Gelegentlich wird angeführt, dass trotz allem die Gefahr besteht, zu vereinsamen. Immerhin entfallen gemeinsame Frühstücke und Mittagessen und andere Gelegenheit für den „echten“ persönlichen Austausch. Hier gilt es, sich Mechanismen zu überlegen, die das auszugleichen versuchen. Beispielsweise lässt sich ein gemeinsames Frühstück auch per Videotelefonie veranstalten. Das ist natürlich nicht ganz das Gleiche, kann aber dennoch sehr unterhaltsam und interessant sein und zu dem Gefühl beitragen, nicht alleine zu sein. Auch die regelmäßige Beteiligung im Chat und eine zügige Hilfestellung, wenn jemand Probleme äußert, tragen massiv dazu bei, zu verhindern, dass Menschen sich alleine gelassen fühlen.
Abgesehen davon ist es eine gute Idee, sich gelegentlich persönlich für ein paar Tage zu treffen. Das kann für einen Ausflug sein, bei dem das Beisammensein als Gruppe im Vordergrund steht; es kann aber auch für eine fachliche Veranstaltung wie den gemeinsamen Besuch einer Konferenz sein.
So oder so wird die gemeinsam verbrachte Zeit in aller Regel weitaus höher geschätzt als bei einer Zusammenarbeit vor Ort. Das Treffen der Kollegen wird auf einmal von einem tagtäglichen Ritual, über das man vor Ort nicht nachdenkt, zu etwas Besonderem, das man wertschätzt und auf das man sich freut.
Fazit
Wie sich zeigt, ist das vollständige Arbeiten aus der Ferne machbar, aber mit Herausforderungen verbunden. Neben den bereits erwähnten Aspekten der Hardware, der Software und der Kultur gibt es noch zahlreiche weitere Aspekte, die zu beachten sind, insbesondere wenn die Zusammenarbeit länderübergreifend erfolgt. Dazu zählen nicht nur offensichtliche Dinge wie unterschiedliche Zeitzonen, sondern auch rechtliche Besonderheiten, diverse Fragen bezüglich Steuern und Krankenkassen, die Frage nach dem Umgang mit landesspezifischen Feiertagen und so weiter.
Der allerwichtigste Punkt ist bei allem aber, dass das verteilte Arbeiten gewollt sein muss – und zwar von allen. Es funktioniert nur dann, wenn Unternehmen wie Arbeitnehmer an einem Strang ziehen und beide bereit sind, für die positiven Aspekte, die sich darauf ergeben, auch die negativen Aspekte in Kauf zu nehmen. Remote-Arbeit ist keine magische Silberkugel, die alle heute bestehenden Probleme der Arbeitswelt löst. Ebenso ist sie auch keine unheilvolle Bedrohung, die ausschließlich neue Probleme aufwirft. Es ist unterm Strich einfach eine andere Art zu arbeiten, auf die sich die Beteiligten aber einstellen und einlassen müssen.
Essenziell dabei ist, dass für alle die gleichen Voraussetzungen gelten müssen. Wer ein Team vor Ort führt und nur einen oder zwei Mitarbeiter per Online-Verbindung hinzunimmt, der wird mit einer Zwei-Klassen-Gesellschaft zu kämpfen haben: Zu oft werden nämlich die ausschließlich entfernt arbeitenden Mitarbeiter vergessen oder haben mit technischen Problemen zu kämpfen, die den Kollegen vor Ort gar nicht bewusst sind. Es gilt also, für alle die gleichen Voraussetzungen zu schaffen und dafür zu sorgen, dass sich alle als in einem Boot zusammengehörig fühlen – im Guten wie im Schlechten.
Wem das gelingt, der kann als Unternehmen oder als Mitarbeiter von vielen Vorteilen profitieren. Aber alles hat bekanntermaßen seinen Preis. Diesen muss man zu zahlen bereit sein. Deshalb ist es wichtig, sich vorher Gedanken über einen solchen Schritt zu machen und realistisch und ehrlich über die Vorteile, vor allem aber auch über die Nachteile gründlich nachzudenken. Das sorgt dann nämlich letzten Endes dafür, dass die Remote-Arbeit nicht zu einem Albtraum, sondern tatsächlich zu einem in die Realität umgesetzten Traum wird.
Dokumente
Artikel als PDF herunterladen
Fußnoten
- Cali Ressler, Jody Thompson, Why Work Sucks and How to Fix It, Penguin, 2010, ISBN 978-1-59184-292-7